Clemens J. Setz zählt zu den spannendsten Schriftstellern im deutschsprachigen Raum. Seine Bücher werden gefeiert, Literaturpreise fliegen ihm regelrecht zu. Ein Gespräch mit ihm über seine Anfänge, Erfolg und seine letzten Bücher.
Text: Stefan Zavernik
Haben Sie von solch einer Karriere geträumt, als Sie 2002 Ihre Gedichte an die Literaturzeitschrift LICHTUNGEN gesendet hatten?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja keine so direkte Karriere, wenn man Bücher schreibt. Es hängt von zu viel Glück ab.
In der aktuellen Ausgabe der LICHTUNGEN sind Ihre Gedichte aus dem Jahre 2002 wiederveröffentlicht. Was denken Sie, wenn Sie diese heute lesen?
Ich finde sie etwas unbeholfen, aber sympathisch.
Wie wichtig ist das Selbstvertrauen, um als junger Autor durchzustoßen?
Das weiß ich nicht. Es gibt solche und solche. Die Selbstbewussten scheinen einen gewissen Vorteil zu besitzen, sind aber bei Misserfolgen auch leichter am Boden zerstört.
Was hat Ihnen die Veröffentlichung ihres ersten Buches bedeutet?
Ich war high und selbstbesoffen, mein Ego sehr groß und pulsierend, aber nach einer Weile, 3 bis 4 Monaten, fiel mir dann auf, dass das Buch nicht funktionierte, es zerfiel in kleinere Absätze und Mini-Geschichten. Es war einfach kein gutes Buch.
Ihr Interesse für Literatur und das Schreiben entfachten Gedichte von Ernst Jandl. Davor haben Sie sich in erster Linie mit Computerspielen beschäftigt, heißt es. Schwer vorzustellen, dass es eine Zeit in Ihrem Leben gegeben haben könnte, in der Literatur keine Rolle gespielt hat. War es Zufall oder Fügung, die Sie zum Autor werden hat lassen?
Es ist nicht so schwer vorzustellen, dass es eine Zeit gibt, in der mir Literatur nicht so viel bedeutet. Sie bedeutet mir heute zum Beispiel schon viel weniger als damals, wie ich 22 oder 19 war.
Und das Computerspielen?
Die spiele ich heute kaum noch. Vielleicht einmal alle zwei, drei Monate.
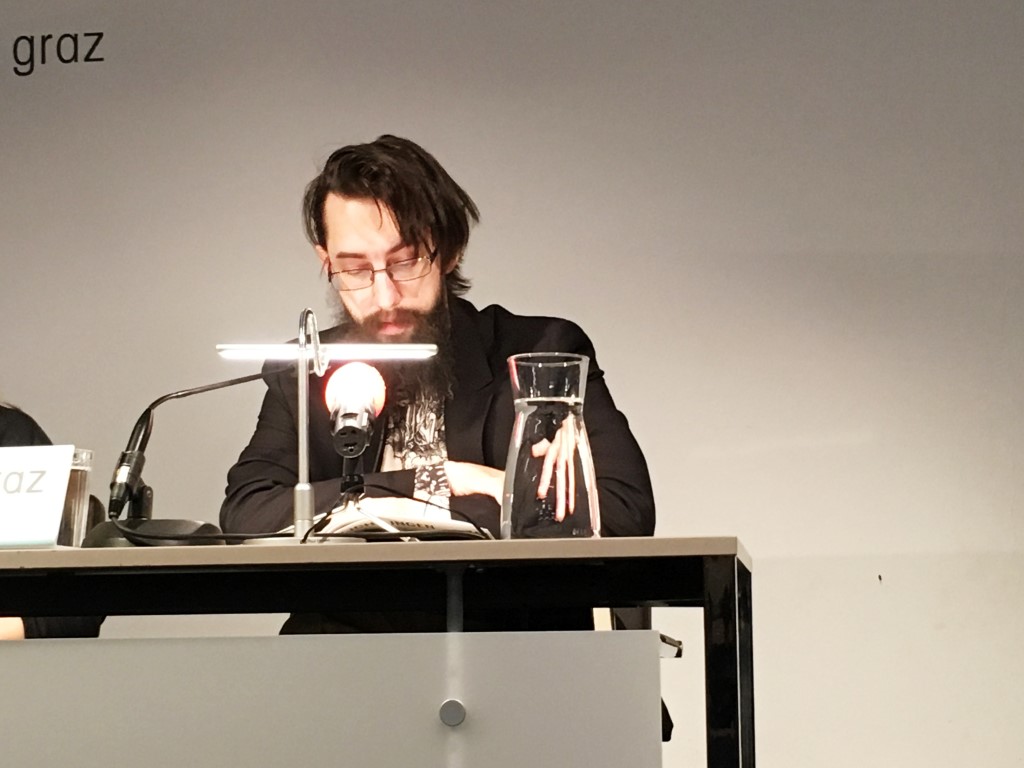
Wie sehr hat sich das Schreiben in den letzten Jahren verändert? Wurde es einfacher? Macht der Erfolg vieles leichter oder wird es schwieriger?
Man muss da, um eine echte Antwort geben zu können, genau definieren, was Erfolg in meinem Fall war. Es gibt Autoren, die verkaufen viele Bücher, können davon leben, haben eine riesige Leserschaft. Zu denen gehöre ich nicht. Mein Erfolg im Literaturgeschäft bestand hauptsächlich aus Förderungen und Preisen. Das heißt, Menschen in einflussreichen Positionen mochten meine Bücher und entschieden sich dazu, diese zu fördern. Dass es ein solches staatliches und privates Förderungssystem für Literatur in der deutschsprachigen Welt gibt, ist ein gewisses Glück. Es bedeutet allerdings auch, dass es keine direkte Kausalität, sondern sogar einen ziemlichen persönlichkeitsverzerrenden Bruch zwischen meiner Produktion und deren „Ertrag“ gibt. Kurz gesagt: Mein Publikum ist nicht mein Publikum.
Haben Sie Ihre Geschichten, Gedichte oder Essays bereits fertig im Kopf oder entstehen diese mit dem Schreiben?
Beides natürlich.
Wie schwierig ist es, als Autor neue Wege zu gehen, neue Geschichten zu erzählen?
Für mich ist es wahnsinnig schwierig.
Warum?
Das hat damit zu tun, dass ich relativ spät im Leben zu lesen begonnen habe, erst so mit 16. Das heißt, ich habe nur ein relativ kleines Arsenal an Lese-Gewohnheiten. Daraus folgt dann auch, dass meine Schreibgewohnheiten relativ klar abgezirkelt sind.
Anfang letzten Jahres erschien Ihr Buch „Bot“. Ihm liegen Ihre Journale zugrunde, Einträge, die Sie seit knapp zehn Jahren in kurzen Texten zu Beobachtungen festhalten. Ursprünglich war das Buch jedoch als klassischer Interviewband gedacht – aber Sie sahen sich nicht in der Lage, persönlich auf die Fragen der Lektorin zu antworten. Warum ist es für Sie schwierig, über Ihr Schreiben zu sprechen?
Ich weiß nicht, vermutlich weil ich dann nur Sätze sagen würde, die wie die Sätze von anderen klingen.

Wann beginnen Sie Dinge zu interessieren – wann kommt etwas in Ihr Journal?
Wenn ich es mit mehr Leuten teilen möchte, als ich persönlich kenne. Dann empfiehlt es sich, es schriftlich festzuhalten. Denn dann ist es möglich, dass es später einmal gefunden oder verwendet wird, und Leute sehen es. So zumindest die Theorie.
Nach welchem Auswahlverfahren haben Sie die Texte aus dem Journal als Antworten für die Fragen ausgewählt? Ist es Ihnen gelungen, sich in einen Roboter zu verwandeln?
Ja, es ist gelungen. Es ist ganz einfach gewesen. Das Verfahren war ganz simpel: Reizwörter aus der formulierten Frage durch Volltextsuche in der Tagebuch-Datei aufspüren – und dann den Absatz reinkopieren.
Haben Sie als „Bot“ auch zensiert?
Nein.
In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung bezeichnen Sie das Dokument als „ausgelagerte Seele“, es wäre umfangreich genug, um Sie rekonstruieren zu können. Sind die Menschen in Ihren Augen dann doch nicht so einzigartige Schöpfungen?
Wir sind einzigartig und einander sehr ähnlich. Diejenigen, die predigen, dass wir den anderen Menschen niemals verstehen können, sind für mich wie Computerspielgegner, die ich besiegen muss. Sie tun auf Erden nichts Gutes.
Dieses Jahr erschien Ihr neues Buch „Der Trost runder Dinge“. Die darin agierenden Charaktere erhalten Trost auf unterschiedlichste, oft bizarre Art und Weise. Was hat Sie dazu geführt, ein ganzes Buch dem Thema „Trost“ zu widmen?
Es geht in dem Buch nicht in jeder Geschichte um Trost. Bei Kurzgeschichten sucht man halt so einen passenden Titel, der interessant genug klingt. Trost scheint mir kein häufig in der erzählenden Literatur betrachtetes Thema zu sein. Aber er ist doch ein recht zentraler Faktor im menschlichen Leben. Deshalb habe ich ihn in zwei oder drei Geschichten ein wenig umrissen, als Phänomen.














