Mit an Ikonen angelehnten Malereien und einer Skulpturselektion aus den letzten 20 Jahren bietet Judith Zillich in der Schau „Mutter Gottes“ im Kultum einen sehr intimen und mutigen Zugang zum Thema Mutterschaft.
Text: Lydia Bißmann
Die aktuelle Winterausstellung Mutter Gottes in der Kultum Galerie beschäftigt sich weniger mit der Figur der schönen Madonna, wie wir sie von Renaissance-Bildern kennen, sondern vielmehr mit der Beziehung zwischen zwei Individuen. Zwischen Mutter und Kind, aber auch zwischen der Künstlerin und dem Betrachter. Judith Zillich ist in Graz geboren, studierte in Wien Kunst und Philosophie und ist in Sammlungen der Stadt Wien, des Landes Salzburg und der Deutschen Bank vertreten. Die Einzelausstellung umfasst um die 80 Eitempera-Malereien, in denen sich die Künstlerin mit der Formensprache und Symbolik orthodoxer Ikonen auf ihre eigene Art auseinandersetzt, und einer Auswahl an Plastiken. Die teilweise sehr feinen Pinselstriche und die höchstens in zwei Farben ausgeführten Figuren von Frauen, Kindern und Körpersegmenten kommen auf den ersten Blick friedlich, sanft und ätherisch daher. Sie sind aber mehr als das. Judith Zillichs Arbeiten nehmen sofort einen Dialog mit dem Rezipienten auf und es ist kein flauschiger Small Talk. Es geht um Themen wie Generationenkonflikt, den Schmerz in der Liebe und die leidige „Lose-lose-Situation“ von Frauen.
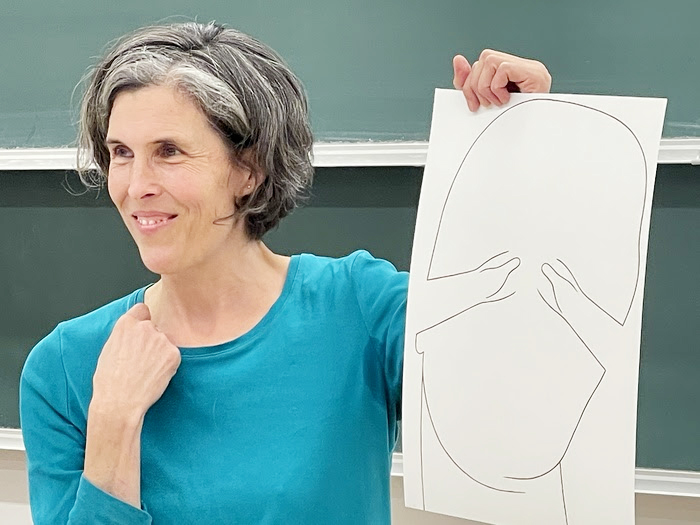
Die Schrift der Ikonen
Ikonen selbst haben Judith Zillich eigentlich nie interessiert. Sie konnte mit den „Monstern gleichen“ Gesichter eher wenig anfangen. Mit einem Auslandsstipendium des Landes Salzburg wollte sie sich vorerst nur die traditionelle Malweise aneignen und schrieb sich vor drei Jahren dafür in Lviv (Lemberg) in eine einschlägige Schule ein. Die Darstellung und die Technik dieser Art von Kunst hat sich seit dem 12. Jahrhundert kaum verändert. Grobkörnige Farbpigmente werden mit ganz wenig Wasser und Eidotter vermischt. Sparsam und ökologisch, weil man nur ganz wenig davon braucht. Beim Malen der Heiligen gibt es ganz klare Vorgaben – es ist vorbestimmt, wo der Mund, die Augen, die Grübchen oder die „Schokocremelocken“ hinkommen und wie weit alles voneinander entfernt sein darf. Aus diesem strengen Regelwerk hat Judith Zillich dann begonnen, bestimmte Elemente herauszulösen, und eigene „Logos“ daraus zu bauen. In dem „Schreiben von Ikonen“, wie sie es auch nennt, bekommen Linien oder Kreise einen anderen Auftrag und bilden neue Informationen. Die immer mehr reduzierte Lippenlinie von Maria verwandelt sich so nach zwei, drei Blättern auf einmal in eine Berglandschaft. Aus der Hand des Jesuskindes, die sich für Ikonendarstellung so typisch in Richtung Wange der Mutter streckt, baut sie dieser eine Dornenkrone oder lässt die Kinderarme mitten in das Gesicht der Madonna langen. So wird aus einer zärtlichen Geste etwas Aggressives, das aber ebenso seinen Platz hat, oder vielmehr haben muss, in der Erzählung von Mutter und Kind.

Foto: Zillich
Formen ohne Barrieren
In der Ausstellung sind die Blätter ohne Rahmen an der Wand befestigt, die Beschriftungen teilweise direkt auf die Mauer geschrieben. Diese spartanische Inszenierung schafft Nähe und Vertrautheit und unterstreicht den Verwendungszweck der Ikonen als Gebrauchsgegenstand. Die Heiligentafeln können eine Zimmerecke im Handumdrehen in einen Altar verwandeln, in Miniaturform auf Reisen mitgenommen werden, werden berührt, gestreichelt und oft geküsst. Ikonenkunst wird als Handwerk und Arbeit verstanden. Hier gibt es kaum künstlerischen Spielraum. Trotzdem seien alle echten Ikonen Selbstporträts, behauptet Judith Zillich, die ebenfalls jahrzehntelang Selbstporträts gemalt hat. In dieser ganzen Starrheit der Komposition und Ausführung dieses Genres, das sie sorgfältig aufgedröselt und neu zusammengesetzt hat, liegt immer etwas von den Frauen selbst, die die jeweiligen Heiligen nach dem ewig gleichen Schema meist für westliche Kundschaft kopieren. Überprüfen lässt sich das schwer – Ikonenmalerinnen und -maler bleiben anonym und signieren ihre Bilder nicht.

Beziehung und Körper
Im Skulpturenraum der Werkschau sind plastische Werke aus fast zwei Jahrzehnten luftig und hell arrangiert. Judith Zillich ist in erster Linie Malerin, hat aber jedes Jahr eine Skulptur angefertigt, die sich mit dem Thema Mutter und Kind befasst. Zu Beginn wartet eine ägyptisch anmutende Frauenfigur, die ihren Kopf in den Armen verbirgt. Angst vor Schwangerschaft heißt die Arbeit, von der man den Kopf als Deckel abnehmen kann und dann in ein leeres Gefäß blickt. Eine kleinere Arbeit erinnert an einen Phallus, stellt aber eine Frau mit gleich zwei Kindern, die als Anhängsel schwer nach unten ziehen, dar. Andere Werke erinnern an Hans Bellmers kopflose Puppenskulpturen und formen einen endlosen Rücken namens Power. Auf den ersten und auch zweiten Blick liebevolle Umarmungen von Mutter und Kindern lassen bei genauerer Betrachtung angestrengte Züge im Gesicht der Frau erkennen. Liebe kann auch sehr viel Kraft kosten und an körperliche Grenzen gehen. Es ist das Spiel aus sehr viel Nähe und vornehmer Distanz, die dem Werk von Zillich Spannung verleiht, aber auch Hoffnung gibt. Sie führt die Betrachter an tief scheinende Abgründe heran, gibt ihnen aber auch durch den radikalen Verzicht auf Drama, Kitsch oder sonstigen Ballast Raum für Balance, damit man sich in aller Ruhe fangen und sammeln kann und nicht darin abstürzen muss.

Judith Zillich: Mutter Gottes
Kurator: Johannes Rauchenberger
Ausstellungdauer: bis Sa, 12.2.2022
Öffnungszeiten: Di–Sa, 11–17 Uhr, So, 14–17 Uhr
KULTUM Galerie, Mariahilferplatz 3














