Julia Knaß (mischen) und Stefan Schmitzer (perspektive) laden am 18. März zur zweiten Auflage des progressiv-poetischen Leseabends „ver s treuen“ ins Café Kaiserfeld. In legerer Atmosphäre und bei freiem Eintritt sind vier markante Stimmen der zeitgenössischen Lyrik zu hören.
Interview: Sigrun Karre
Die Veranstaltung „ver s treuen“ versteht sich als „poetischer Nachtrag zu 2024“ – Gibt es eine Leerstelle, die ihr damit füllen wollt?
Julia Knaß: Wir möchten bedeutende Lyrikerinnen des vergangenen Jahres in den Mittelpunkt rücken. Etwa Frieda Paris, die mit dem Langgedicht Nachwasser den österreichischen Debütpreis gewann, oder Max Czollek, dessen Buch Gute Enden gesellschaftliche Debatten aufgreift. Auswahlkriterien sind die Herausgabe eines bedeutenden Werkes im Bereich der Lyrik oder die Verleihung eines bedeutenden Literaturpreises.
Stefan Schmitzer: Im Grunde ist es eine literarische Jahresrückschau – wir überlegen, welche wichtigen Stimmen in Graz gefehlt haben. Dabei wollen wir uns nicht nur auf mischen oder perspektive konzentrieren, sondern bewusst den Blick weiten.
Auch Oswald Egger, ein prägender Impulsgeber der Avantgarde und Georg-Büchner-Preisträger 2024, wird bei der Lesung dabei sein. Welche aktuellen Tendenzen in der Lyrik findet ihr besonders spannend?
Stefan Schmitzer: Uns interessieren weniger bestimmte Themen als die Frage: Von welchem Werk geht ein nachhaltiger Impuls auf das gesamte Feld aus? Bei Oswald Egger etwa sieht man eine Tendenz, die fast schon wieder „abgefrühstückt“ ist – das enzyklopädische, katalogische Schreiben, aus dem sich die aktuelle Renaissance des Langgedichts entwickelt hat. Spannend finde ich auch den Einfluss von Google auf die Lyrik – insbesondere dort, wo entlegene Begriffe unkommentiert stehen bleiben, wie in Max Czolleks letztem Gedichtband. Dank dem Internet kann man jederzeit auf Wissen zugreifen, das eröffnet der Lyrik neue Räume und Möglichkeiten.
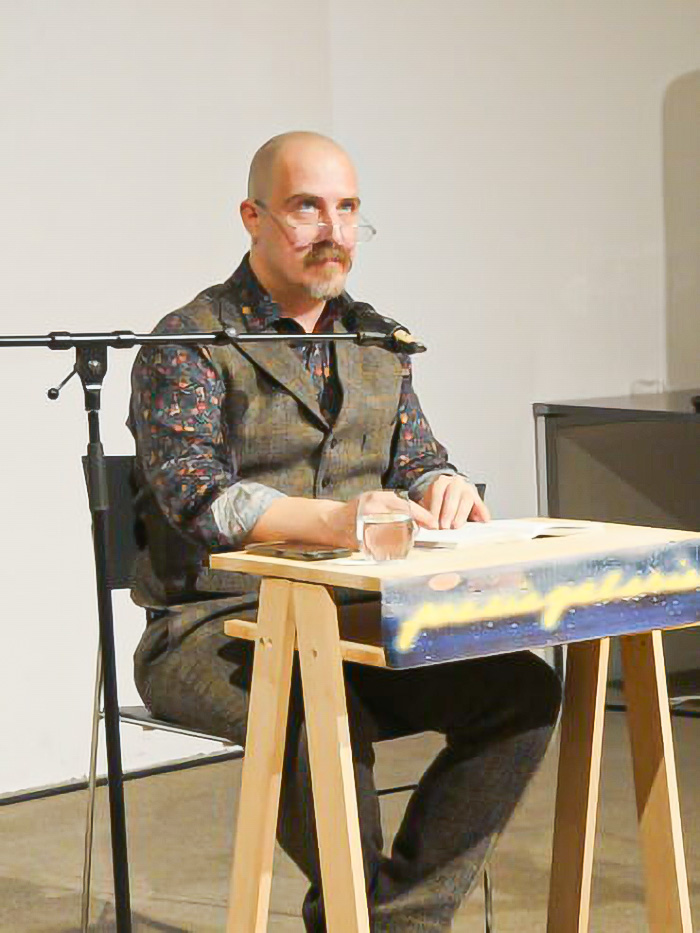
Foto: poesiegalerie
Julia Knaß: Besonders auffällig ist das Comeback des Langgedichts – Frieda Paris zeigt das eindrucksvoll. Außerdem erlebt politische Lyrik eine neue Dringlichkeit und breite Rezeption, wie Max Czollek beweist. Ein weiteres Phänomen ist die Verknüpfung von digitaler und gedruckter Poesie, die zunehmend Einfluss auf die Formen der Veröffentlichung nimmt. In diesem Bereich bewegt sich auch Charlotte Werndt mit ihrem Schreiben, die 2024 ihr Debüt vorgelegt hat, das wir beachtenswert finden.
Lyrik gilt als Nischenformat, wie groß ist diese Nische tatsächlich?
Julia Knaß: Als Lyrikerin, die insbesondere im Internet schreibt, kann ich sagen, es gibt ein Publikum. Lyrik ist eine spielerische Form, das, was rund um einen passiert, in Text zu verdichten. Das wird es immer geben.
Stefan Schmitzer: Es gibt ein wachsendes Interesse an anspruchsvoller Lyrik. Unsere Veranstaltung Verstreut 2024 war gut besucht – und nicht nur von Literaturwissenschafter*innen. Es gibt ein Bedürfnis nach Komplexität. Labels wie „populär“ oder „elitär“ haben mit dem Werk selbst nichts zu tun. Die Vorstellung, dass Lyrik nur für einen kleinen Kreis relevant sei, ist schlicht falsch – entscheidend ist, wie sie präsentiert wird.
mischen und perspektive – worin unterscheiden sich die zwei Literaturzeitschriften in ihrer Ausrichtung, wo gibt es Schnittmengen?
Julia Knaß: mischen gibt es seit 2019 – ein junges Projekt mit feministischer Ausrichtung, das aus dem Internetumfeld entstanden ist. Wir experimentieren gerne mit kollektivem Schreiben im Netz, geben in unregelmäßigen Abstanden aber auch ein gedrucktes Heft heraus. Meinem Eindruck nach setzt sich perspektive stärker mit formalen und theoretischen Fragen auseinander.
Stefan Schmitzer: perspektive ist 1979 aus einer universitären Diskursschiene entstanden, also 40 Jahre älter und hat seither einige Wandlungen durchlaufen. Beide Zeitschriften kommen aus unterschiedlichen Diskursen und wollen unterschiedliche Dinge. Aber genau darin liegt die Stärke: Gemeinsam decken wir ein breites Spektrum ab. Unsere Schnittmenge liegt dort, wo wir Neues entdecken.

Foto: el menges
Welcher lyrische Ohrwurm oder welches Gedicht begleitet euch schon länger?
Stefan Schmitzer: Da habe ich jetzt tatsächlich lauter klischeehafte Antworten: Die Unsura-Cantos von Ezra Pound, die aus 100 Gründen total problematisch, weil wirklich programmatisch faschistisch sind, habe ich sehr lebendig im Ohr. Dann Howl von Allen Ginsberg und dann Paul Celans Fadensonnen. Letzteres Gedicht geht über ästhetisches Gefallen natürlich weit hinaus. Wenn ich versuche zu erklären, warum Lyrik wichtig ist, welche Programmatik man damit erzeugen kann, finde ich immer wieder diese sechs Zeilen mit der Wendung jenseits der Menschen sehr instruktiv.
Julia Knaß: Mir kommt oft eine Zeile aus Sonja Seidels Gedicht Menschlicher Marsrover in den Sinn, das auch in mischen erschienen ist: Was machte sie in ihrer Abgeschiedenheit / den Wald auf Unregelmäßigkeiten prüfen.
Stefan Schmitzer: Sehr schön, ich bin dafür!
Julia Knaß: Und dann gibt es noch Herta Kräftner – die habe ich manchmal im Ohr. Mein Guilty Pleasure ist aber, dass ich in der Schulzeit Gedichte von Heinrich Heine auswendig gelernt habe. Das hatte rein praktische Gründe: Sich selbst Gedichte aufzusagen, ist ein guter Lifehack, um Gedankenschleifen zu durchbrechen.
ver s treuen
Zeitgenössische Lyrik zusammengestellt von perspektive & mischen
Mit Max Czollek, Frieda Paris, Oswald Egger & Charlotte Werndt
Di, 18.3.2025
Kaiserfeldgasse 19, 8010 Graz
www.perspektive.at
www.mischen.at














